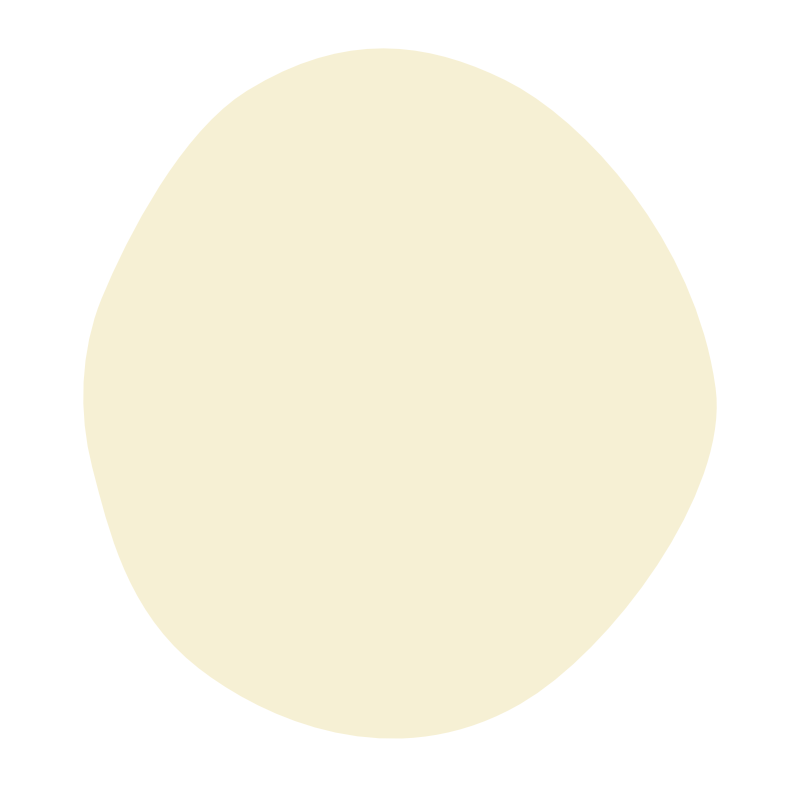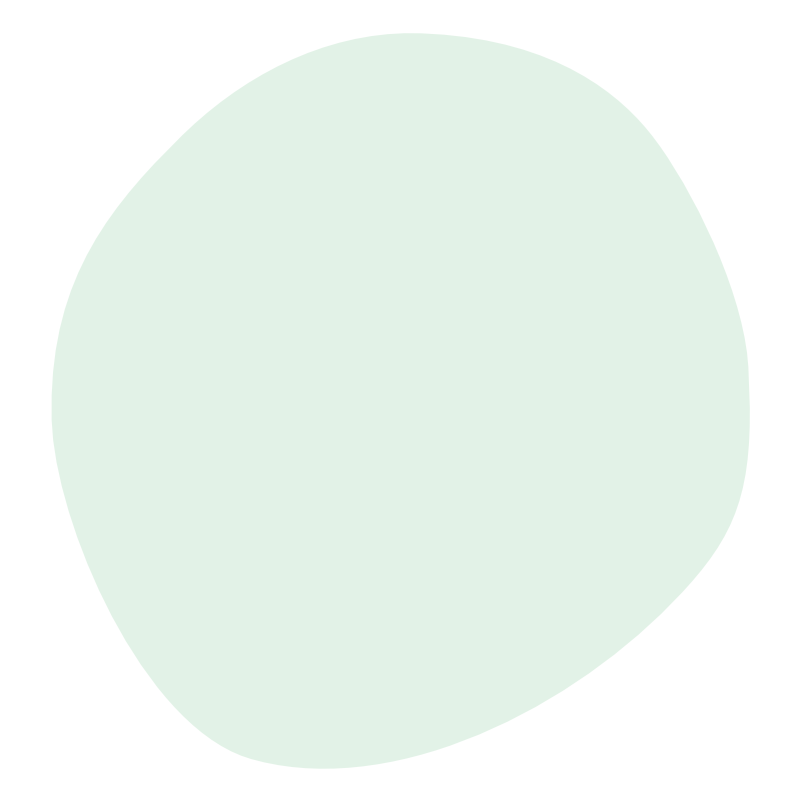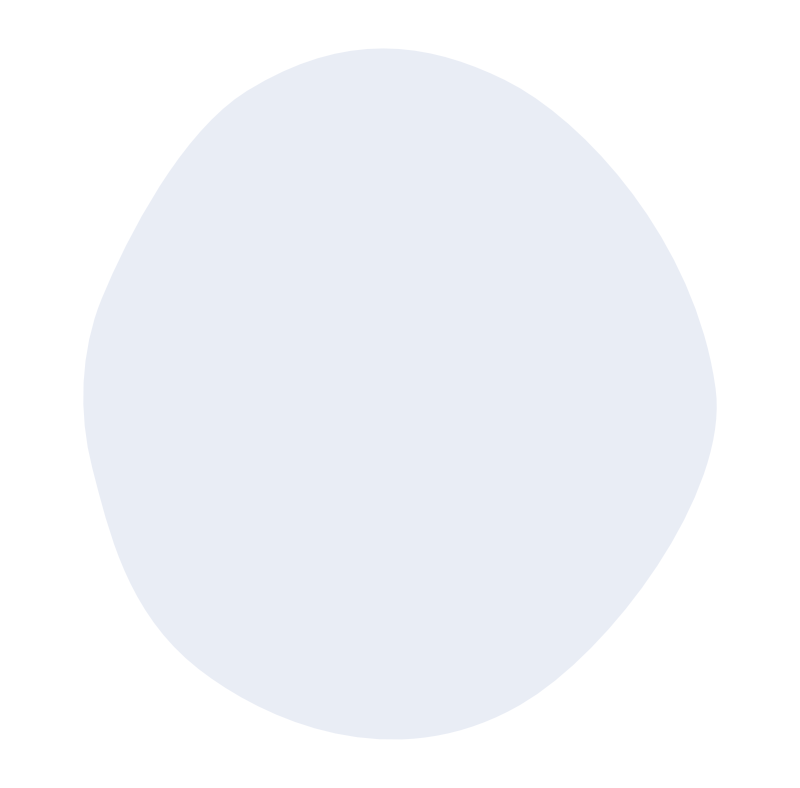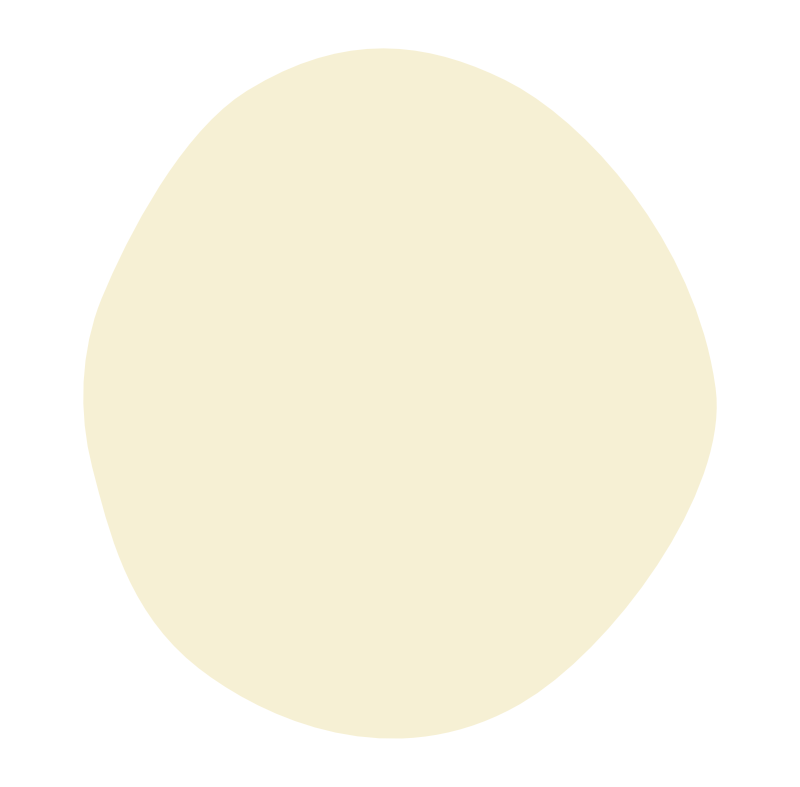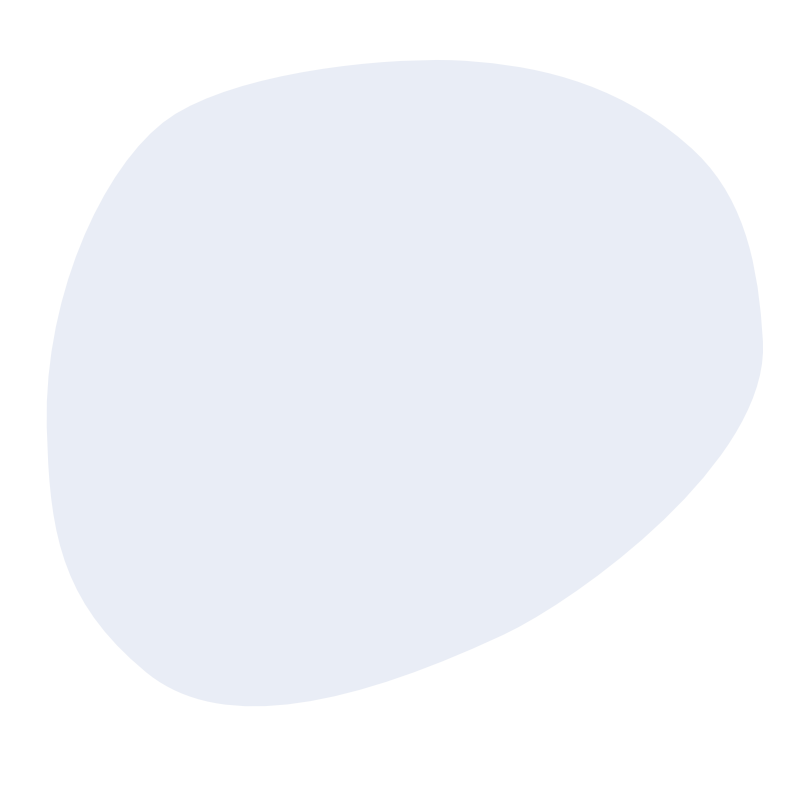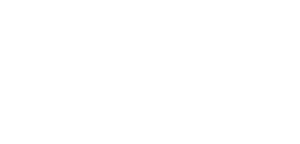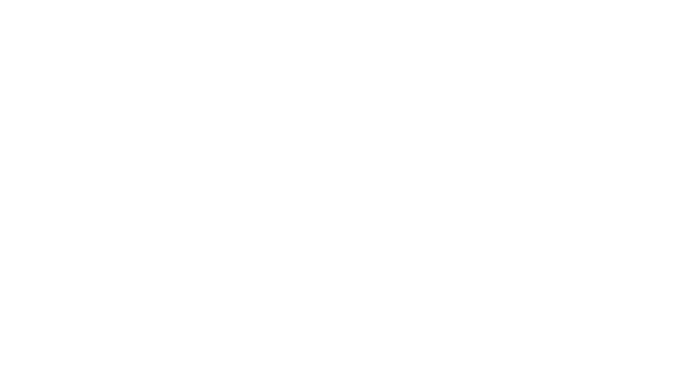Der Online-Kurs für Fachkräfte ist jetzt für alle zugänglich! Hier finden Sie alle Informationen zur Anmeldung und zum Kursstart:
Zum Online-Kurs
Aktuell läuft der zweite Durchgang der Multiplikator:innen-Ausbildung und wir sind begeistert von den sensationellen Teilnehmer:Innen! Bei Interesse können Sie sich ab jetzt für den nächsten Durchgang anmelden und ihre Bewerbung abschicken:
Infos zur Multiplikator:innen-Ausbildung
Wir arbeiten intensiv an einem modernen Fortbildungskonzept mit blended learning sowohl für einzelne Teilnehmer:innen als auch als Team-Fortbildung für Kitas, Träger oder Städte und Gemeinden. Bei Interesse tragen Sie sich bitte hier ein:
Infos zu Fortbildungen
Das Kartenset zur Partizipatorischen Eingewöhnung ist da und es ist wunderschön geworden! Ein tolles Werkzeug für Fortbildungen, die Arbeit im Team, die eigene Reflexion und für die Elternbegleitung in der Eingewöhnung.
Infos und ein Video zum Kartenset
Der Film bzw. die DVD zum Partizipatorischen Eingewöhnung ist erschienen! Ein informativer, inspirierender und praxisorientierter Film, der wichtige Perspektiven und Anregungen für die Weiterentwicklung von Eingewöhnungsprozessen in Kitas liefert.
Infos zu Film und DVD