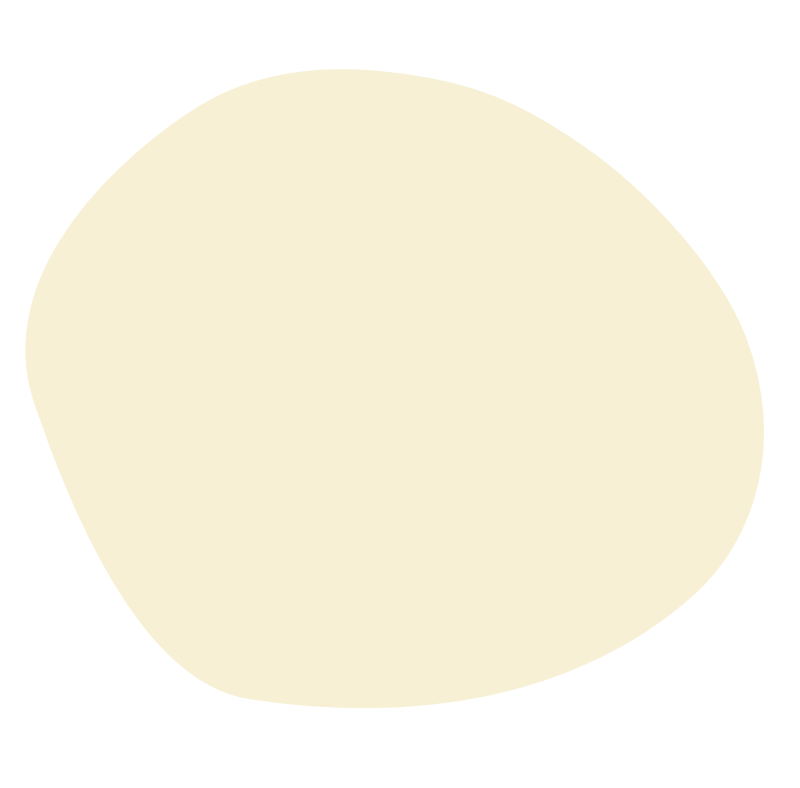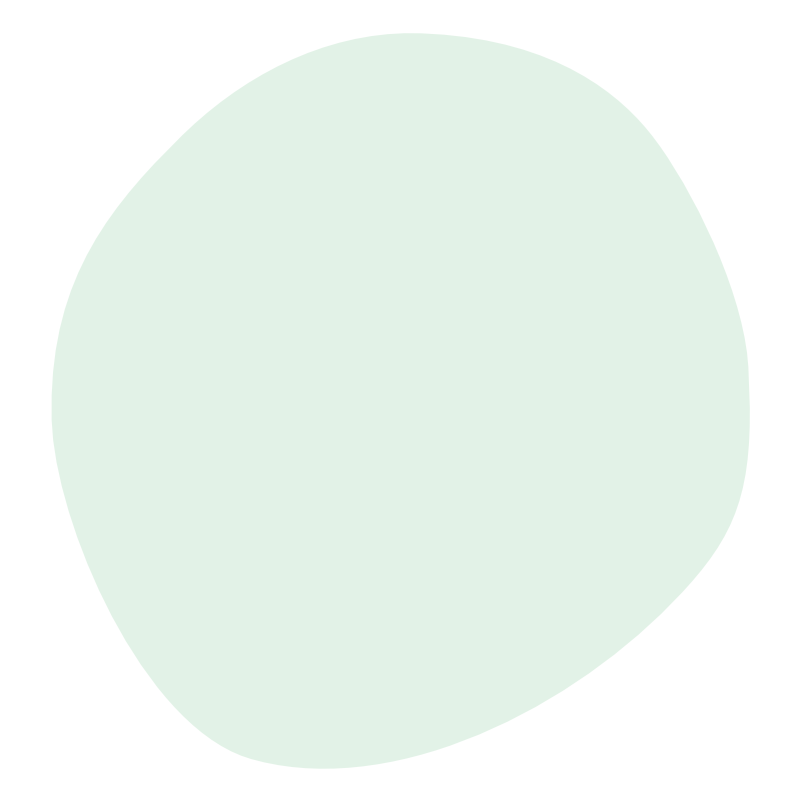Partizipatorische Didaktik
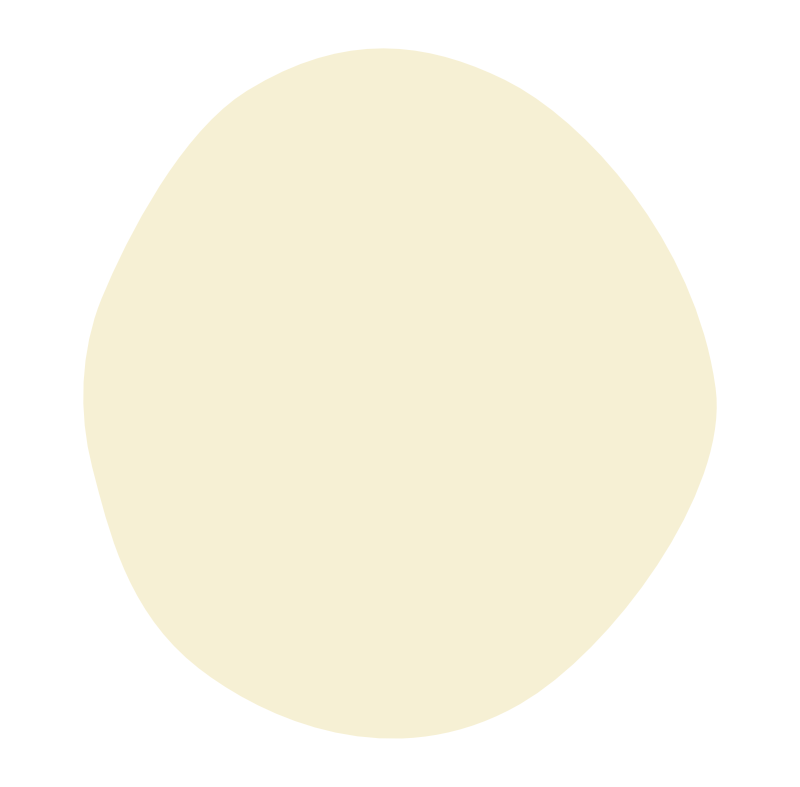
Partizipatorische Didaktik
Der Partizipatorischen Eingewöhnung liegt ein bildungswissenschaftliches Verständnis zugrunde, das der „Verwirklichung von Selbsttätigkeit“ (Schäfer 2011, S. 14) und der aktiven Auseinandersetzung mit der Welt eine zentrale Rolle zuschreibt. Bildung wird demnach als Wechselwirkung zwischen dem Ich und der Welt verstanden. „Das Subjekt braucht ein Gegenüber, durch das es sich bilden kann“ (Schäfer 2011, S. 13 f.; von Humboldt 1969; Laewen 2002). Selbstbildung vollzieht sich somit immer nur in der Auseinandersetzung mit einer kulturellen und sozialen Welt, entlang von Ereignissen und Erfahrungen in sozialen und kulturellen Lebenszusammenhängen (vgl. Schäfer 2005; 2011; Alemzadeh 2021). Dabei entwickelt jedes Kind eigene Handlungs- und Denkmöglichkeiten, die für seine individuelle Lebensgeschichte wichtig sind und dazu beitragen, aktuelle Aufgabenstellungen zum jeweiligen Zeitpunkt seiner Biografie zu bewältigen (vgl. Schäfer 2019, S. 87).
Geht man von dem oben skizzierten Bild vom Kind als kompetentes, individuelles Subjekt aus, das sich aktiv mit seiner Welt auseinandersetzt (Rinaldi 1993; Schäfer 2005; 2011; 2018), so muss man bereits in der Eingewöhnung einen anderen Fokus setzen: In erster Linie geht es dann nicht mehr darum, wie sich das Kind am besten und schnellsten den neuen alltäglichen Routinen anpasst, sich von der primären Bezugsperson löst und sich von den pädagogischen Fachkräften versorgen lässt. Vielmehr steht im Vordergrund, wie es gelingen kann, dass Kinder die neue Situation als positive Herausforderung wahr- und annehmen. Nach diesem bildungswissenschaftlichen Verständnis von „Eingewöhnung“ müsste man einen neuen Begriff wählen, da Kinder sich nicht anpassen und an etwas gewöhnen, sondern aktiv einleben sollen.
Das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell ist somit Teil einer Partizipatorischen Didaktik (Alemzadeh 2021), in der Verständigung ins Zentrum pädagogischer Prozesse rückt. Eingebettet ist die Didaktik in einer Kultur des Lernens, die mindestens fünf Perspektiven beinhaltet (Schäfer 2019, S. 86):
- Selbstbildungspotenziale
- Beziehungspotenziale
- Sachpotenziale
- Strukturpotenziale
- Kulturpotenziale
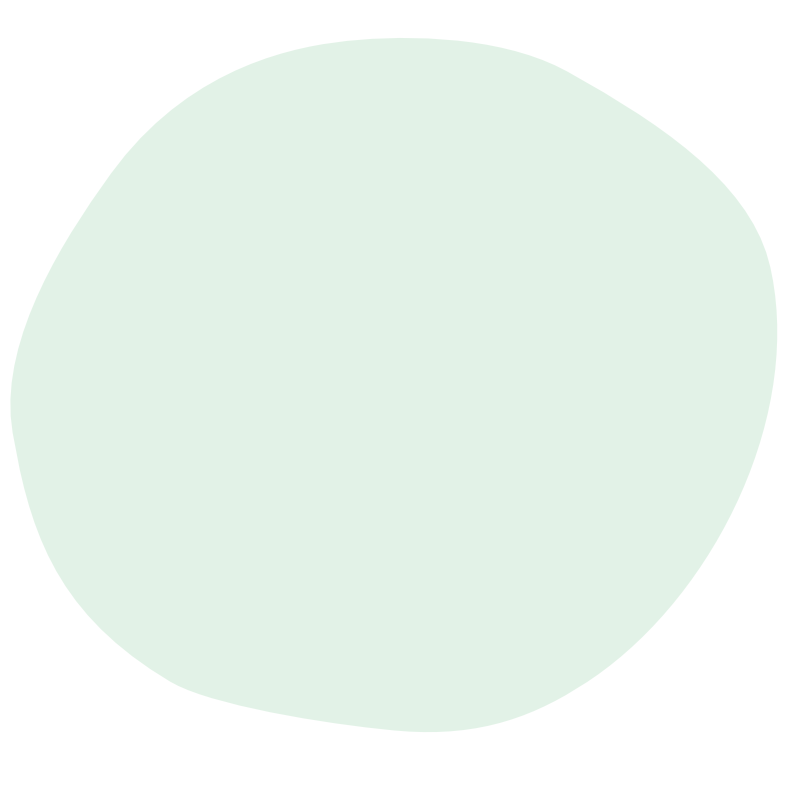
1. Selbstbildungspotenziale:
Selbstbildungspotenziale beschäftigen sich vor allem mit der „Verwirklichung der Selbsttätigkeit“ (Schäfer 2011, S. 14). Mit Selbsttätigkeit ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass Kinder die Gelegenheit und Rahmenbedingungen erhalten, sich aktiv mit ihrer Welt auseinandersetzen zu können. Gerade in Bildungsprozessen setzen sich Kinder mit ihrer Um- und Mitwelt auseinander und entwickeln hierbei ihr eigenes Bild von sich und der Welt. Dabei wird deutlich, dass Bildung durch die wechselseitige Beziehung zwischen dem Subjekt und der Welt entsteht.
Im Zentrum der Partizipatorischen Didaktik steht diesbezüglich die Frage, welche Ressourcen (individuelle biografische Erfahrungen, verschiedene Lebensbedingungen) den Kindern zur Verfügung stehen, wenn sie beginnen, ihre Welt zu erfassen und kennenzulernen. Die eigenen Ressourcen der Kinder sind die Grundlage, um Selbstbildungsprozesse entstehen zu lassen. Als Selbstbildungspotenziale werden Handlungs- und Denkmöglichkeiten bezeichnet „die ein Individuum im Verlaufe seiner Biografie entwickelt hat, um sich in der Welt orientieren, darin leben, handeln und denken zu können. Sie gehen von den Möglichkeiten aus, die mit der Geburt gegeben sind, und erweitern sich in dem Maße, in dem sie in konkreten Lebenssituationen tatsächlich angewendet werden“ (Schäfer 2012, S. 23).
In einem ersten Anamnesegespräch zwischen Bezugserzieher*in und Eltern des Kindes werden die Eltern eingeladen, über Vorlieben des Kindes und dessen Interessen sprechen. Natürlich sollten sie auch erzählen, welche Bereiche das Kind nicht interessieren und ob das Kind bspw. Ängste vor oder Abneigungen gegen bestimmten Dinge hat. Durch diese Informationen, die die pädagogische Fachkraft im Vorfeld erhält, kann sie im späteren Verlauf der Eingewöhnung einfacher mit dem Kind in Kontakt treten, da sie z. B. gezielt auf die Vorlieben und Interessen des Kindes eingehen kann. Wenn die pädagogische Fachkraft bspw. weiß, dass das Kind sehr interessiert am Wasserspiel ist und viel Freude dabei hat, kann sie gezielt eine Spielsituation am Waschbecken initiieren, indem sie z. B. verschiedene Schüttgefäße für das Kind bereitstellt. Sie lädt das Kind in Anwesenheit seiner Bezugsperson zu der vorbereiteten Umgebung ein und kann während des Wasserspiels gut in Kontakt zum Kind treten, indem sie die Spielsignale des Kindes feinfühlig beantwortet. Wenn das Kind sich hier gesehen und wahrgenommen fühlt, wird es sicher öfter den Kontakt zu der pädagogischen Fachkraft suchen und Stück für Stück eine Beziehung zu ihr aufbauen.
Um die Selbstbildungsprozesse der Kinder ab dem Beginn der Eingewöhnung gut unterstützen zu können, spielt die Wahrnehmende Beobachtung eine besondere Rolle. Durch Wahrnehmendes Beobachten können die vielen verschiedenen Stimmen der Kinder gehört werden, um ihnen individuell und angepasst an ihre kindlichen Bedürfnisse zu antworten.
Die Wahrnehmende Beobachtung nimmt eine zentrale Stellung ein, wenn man sich als Bildungsbegleiter*in des Kindes versteht – als eine Person, deren Aufgabe es ist, eine anregende Umgebung zu schaffen, als Dialogpartner*in zu fungieren, kindliche Bildungsprozesse zu begleiten, anzustoßen und herauszufordern. Die Wahrnehmende Beobachtung dient dann zur differenzierten Grundlage sowohl für einen Beziehungsaufbau, als auch für die weitere pädagogische Arbeit mit den Kindern (vgl. Alemzadeh 2016).
2. Beziehungspotenziale
Selbstbildungsprozesse vollziehen sich fast immer in der Auseinandersetzung mit einer sozialen Welt, also in der Beziehung mit anderen. „Welche Lern- oder Bildungsprozesse stattfinden, wird von der sozialen Situation mitbestimmt, in der sich der bildende Mensch vorfindet“ (Schäfer 2019, S. 157).
Aus verschiedenen Forschungen wird deutlich, dass Kinder vor allem dann explorieren, wenn sie sich auf eine Bezugsperson, einen sogenannten „Sicheren Hafen“ verlassen können, der ihnen Sicherheit und Geborgenheit gibt (vgl. z. B. Ainsworth 1964; 2003; Brisch 2008; 2014; 2017). Das bedeutet, dass Kinder ihre Umwelt vor allem dann neugierig wahrnehmen und erkunden können, wenn sie sich sicher fühlen.
Mary Ainsworth (1964/2003) sprach von der „Feinfühligkeit“ der erwachsenen Personen, die ein Kind begleiten. Wenn der Erwachsene die kindlichen Signale wahrnehmen und angemessen darauf reagieren kann, fördert dies eine sichere Bindung und bildet die Grundlage für die kindlichen Bildungsprozesse. Säuglinge und Kleinkinder brauchen außerdem in ihrer Affektregulation und Impulskontrolle noch die unmittelbare Unterstützung und Begleitung von vertrauten Personen. Während der Eingewöhnung werden die Pädagog*innen zu weiteren vertrauten Bezugspersonen für das Kind, die in kritischen Situationen emotional verlässlich und mit Blickkontakt verfügbar sind und den Kindern helfen, ihr Befinden, ihre Bedürfnisse und Impulse zu regulieren. Dies setzt voraus, dass die pädagogischen Bezugspersonen die situative Belastung des Kindes angemessen einschätzen können (Papousek et al. 2004; Papousek 2006). Pädagog*innen sollten sich in ihrer Ausbildung deshalb mit der Bindungstheorie so weit vertraut machen, dass sie Bindungsbedürfnisse, die Notwendigkeit von Hilfen zur Affektregulation und Vermeidungsverhalten von kleinen Kindern erkennen und adäquat beantworten können (Brisch et al. 2008).
Zu Beginn der Eingewöhnung ist die Mutter oder der Vater des Kindes die wichtigste und zunächst auch die einzige Bezugsperson, die natürlich auch über den Eingewöhnungsverlauf hinaus immer die wichtigste Bezugsperson bleiben wird. Im weiteren Verlauf der Eingewöhnung versucht die pädagogische Fachkraft Schritt für Schritt, mit dem Kind in Kontakt zu kommen, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Dabei ist es wichtig, dass pädagogische Fachkräfte die verbalen und nonverbalen Signale der Kinder ernst nehmen und in der Gestaltung ihres Beziehungsaufbaus berücksichtigen. Damit dies gelingen kann, wird die „Verständigung als professionelle Aufgabe erachtet“, für die vor allem die Erwachsenen die Verantwortung übernehmen müssen (Alemzadeh 2021, S. 22).
Um professionelle Verständigungsprozesse mit Kindern sicherzustellen, hilft es vor allem, sich in das Verhalten der Kinder einzufühlen, ihre Signale wahrzunehmen und gleichzeitig bereit dafür zu sein, Kindern einen eigenen Raum für Entscheidungen zu öffnen (vgl. ebd.). Wenn Kinder uns bspw. in der Eingewöhnung signalisieren, dass sie noch nicht bereit sind für eine Kontaktaufnahme, was sich z. B. durch körperliches Abwenden zeigen kann, ist es wichtig, dies ernst zu nehmen und dem Kind mehr Zeit zum Ankommen zu lassen. Andererseits könnte ein Kind deutlich signalisieren, dass es noch nicht nach Hause gehen, sondern bspw. am Mittagessen teilnehmen möchte, indem es sich an den Tisch setzt und einen Teller für sich verlangt. Auch hier wäre es wichtig, darauf einzugehen und dem Kind zu vermitteln: „Ich sehe, du möchtest heute gerne mit uns essen. Du kannst gerne bleiben.“ Ein Verständigungsprozess kann aber auch bedeuten, dass die pädagogische Fachkraft antwortet: „Ich sehe, du würdest gerne mitessen, aber ich sehe auch, dass du schon ganz schön müde bist. Du hast dir schon ganz oft die Augen gerieben. Vielleicht kommst du morgen etwas später mit der Mama und bleibst dann noch zum Mittagessen.“ In all diesen Antworten stecken Beziehungsbotschaften, die zeigen, dass die pädagogische Fachkraft feinfühlig auf die Signale des Kindes reagiert und es in seinen Bedürfnissen ernst nimmt.
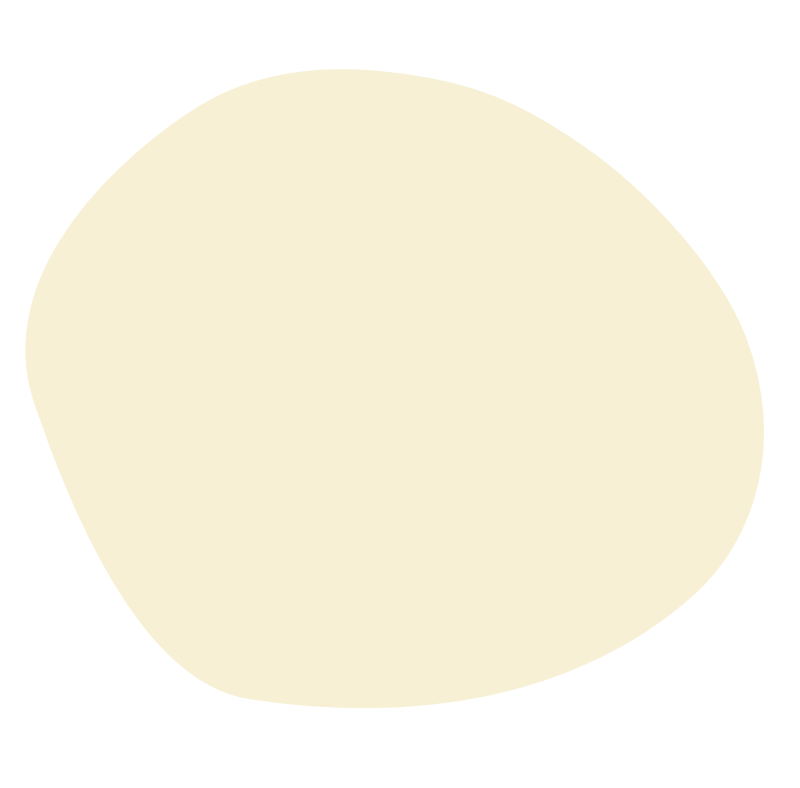
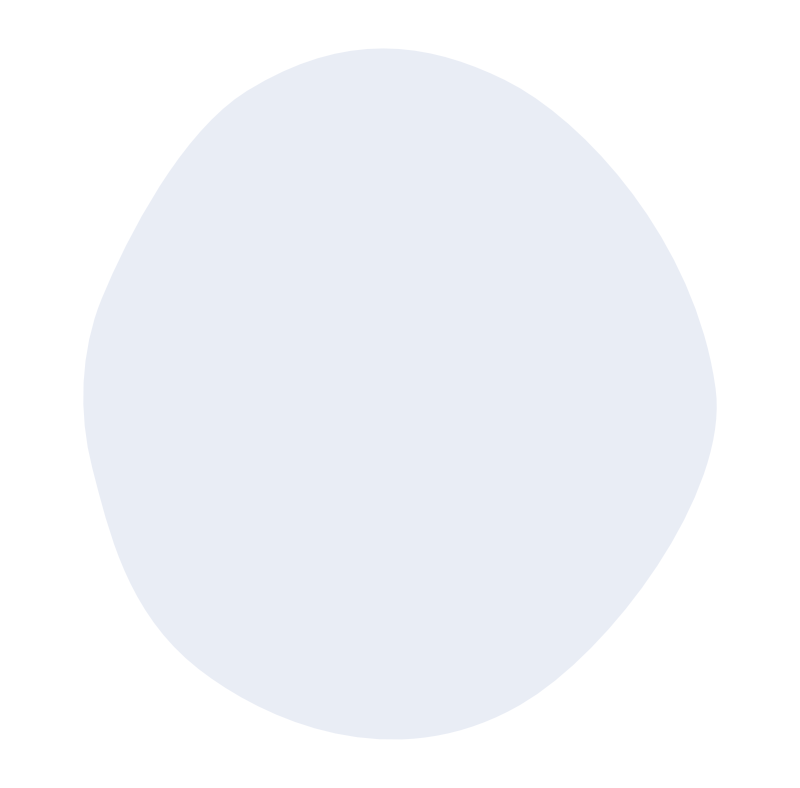
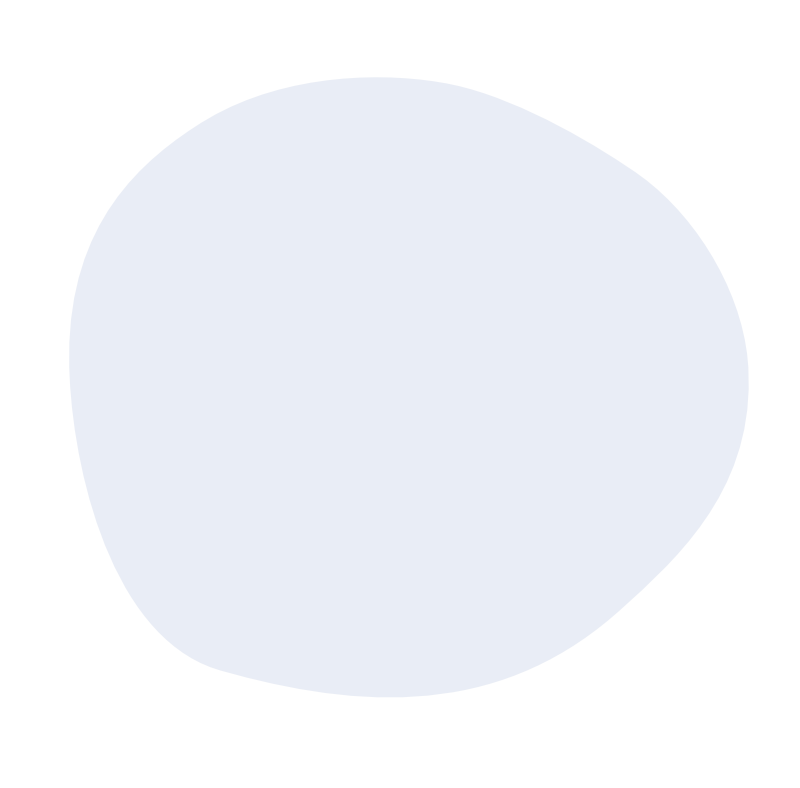
3. Sachpotenziale
Eines der besonderen Erlebnisse von Kindern während der Eingewöhnung ist es, die Erfahrung zu machen, dass es Häuser für Kinder gibt, die speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind. Meist sind die Kinder begeistert, vor allem dann, wenn sie anregende, offene und vielfältige Umgebungen vorfinden, die vielseitige Zugangs- und Ausdrucksweisen ermöglichen und in denen Kinder ihre individuellen Potenziale entfalten können. Selten haben Kinder zu Hause die Möglichkeit, z. B. mit flüssiger Farbe zu malen oder sich in ein Linsenbad zu legen und dessen haptische Erfahrungen zu genießen. Diese neuen Erfahrungen machen die Krippe, Kita oder Tagespflege zu einem spannenden Ort, an dem der Explorationsdrang der Kinder ausgelebt werden darf. Deci und Ryan (1993) betonen drei Grundbedürfnisse, die zum optimalen Explorieren gegeben sein müssen: Autonomie, Kompetenzerleben und soziale Eingebundenheit (vgl. ebd., S. 229). Werden diese Grundbedürfnisse befriedigt, fällt es dem Kind leicht, seine Umwelt zu erkunden und somit seine natürliche Neugier auszuleben. Kinder erschließen sich im Alltag die sachlichen Zugänge der Welt (Alemzadeh 2021, S. 32).
Eine wichtige Aufgabe von pädagogischen Fachkräften besteht darin, Umgebungen zu schaffen, in denen Kinder ihren ganz eigenen Fragen und Interessen in Begleitung aufmerksamer Pädagog*innen nachgehen können. „In erster Linie sind es die Räume drinnen und draußen, die den Kindern für ihre tägliche Neugier zur Verfügung stehen, sowie die Materialien und Werkzeuge, die sie eigenständig für ihre Explorationstätigkeit verwenden dürfen, die über den Grad der kindlichen Beteiligungsmöglichkeiten entscheiden“ (Schäfer 2019, S. 74). Je individueller – angepasst an den jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder – die Umgebungen von den pädagogischen Fachkräften gestaltet werden, desto differenzierter können die Erfahrungen der Kinder werden.
4. Strukturpotenziale
In der Partizipatorischen Didaktik richten sich strukturelle Entscheidungen und Abläufe aus dem Krippen‑, Kita- und Tagespflege-Alltag an den Bedürfnissen der Kinder aus. Dies betrifft z. B. die Struktur und den Aufbau der Gruppen sowie die allgemeinen strukturellen Abläufe und Routinen des pädagogischen Alltags.
Die Tagesstruktur besteht aus verschiedenen Routinen und Schlüsselsituationen, die durch viele Übergangsphasen begleitet werden. Diese sogenannten „Mikrotransitionen“ (Gutknecht/Kramer 2018, S. 8) treten häufig im pädagogischen Alltag auf und werden als schwierige und potenziell belastende Situationen beschrieben, für die eine bewusste Gestaltung notwendig ist. Damit weder die pädagogische Fachkraft noch das Kind Stress während dieser Übergänge erfahren muss, ist eine achtsame Begleitung notwendig. Wahrnehmende Beobachtungen können pädagogischen Fachkräften die achtsame Begleitung erleichtern, da sie anhand ihrer Beobachtungen bspw. erkennen können, welche Situationen das jeweilige Kind als belastend erlebt.
In der Partizipatorischen Didaktik stehen die Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen im Vordergrund. Tägliche Strukturen werden daher nicht strikt vorgegeben, sondern in Einklang mit den Bedürfnissen der Kinder gebracht, damit Kinder und pädagogische Fachkräfte nicht in Stress geraten und Übergänge sanft begleitet werden können. Diese offene und bedürfnisorientierte Tagesgestaltung ermöglicht Kindern vielfältige Erfahrungen.
5. Kulturpotenziale
Unter Kulturpotenzialen können die gesellschaftlichen und kulturellen Kontexte verstanden werden, in denen Kinder heutzutage aufwachsen.
In Deutschland werden Kinder zunehmend als aktive Konstrukteure ihrer Kindheit wahrgenommen. Doch selbst innerhalb einzelner Länder und Kulturen sind die Erfahrungswelten der Kinder sehr unterschiedlich und führen immer zu individuellen Verläufen der Kindheit. So kann in der Familie ein ganz anderes Bild vom Kind gelebt werden als in der Einrichtung – oder umgekehrt. Das bedeutet, dass Kindheit heute auch das Aufwachsen zwischen differenten Lebenswelten bedeutet (vgl. König 2010).
Mit dieser Heterogenität umzugehen, ist in den letzten Jahren eine der bedeutsamsten Aufgaben frühkindlicher Bildung geworden. Es ist entscheidend, ob der Vielfalt mit Offenheit und professioneller Responsivität begegnet wird. In einer Kultur des Lernens wird Partizipation durch Aushandlungsprozesse und inklusives Handeln erreicht.
Gerade in der Zeit, in der Kindertagesstätten zu Orten der Begegnung verschiedener Kulturen werden, spielt ein authentisches gegenseitiges Kennenlernen in der Eingewöhnungsphase eine wichtige Rolle. Sind die Eltern bspw. davon überrascht, dass sie ihr Kind die ersten Tage bzw. Wochen in der Einrichtung begleiten sollen, so kann – je nach eigenem kulturellen Hintergrund – das Argument, dass das Kind langsam eine Beziehung zur pädagogischen Fachkraft aufbauen soll, für die Eltern irritierend sein. In verbundenheitsorientierten Kontexten „bestehen von Anfang an multiple Betreuungskontexte und die Säuglinge werden daran gewöhnt, sich von einer Vielzahl an Personen versorgen und begleiten zu lassen“ (Borke et al. 2011, S. 22). Es ist nachvollziehbar, dass Familien, die ihre Kinder von Beginn an von vielen verschiedenen Personen betreuen lassen, einen solch intensiven und langsamen Beziehungsaufbau zu den neuen Fachkräften – wie oben beschrieben – als nicht notwendig anerkennen und sogar eher von dieser Vorgehensweise irritiert sind. Tatsächlich zeigten Studien, dass Kinder aus verbundenheitsorientierten Kontexten kaum Stress zeigten, wenn sie von fremden Personen begrüßt und auf den Arm genommen werden. Dennoch ist gerade für diese Kinder und ihre Bezugspersonen eine intensive Kennenlernphase genauso wichtig, wenn auch aus anderen Gründen.
„Bei Familien aus anderen kulturellen Kontexten kommt vor allem dem Kennenlernen des Kindes bzw. der Familie für die pädagogische Fachkraft sowie dem Kennerlernen der Betreuungseinrichtung und der zuständigen Erzieherin für die Eltern eine besondere Bedeutung zu. Nicht selten liegen hier bei Eltern andere Vorstellungen davon vor, wie Kindertagesbetreuung für diese Altersstufe aussieht, wie in der Krippe oder Tagespflege die alltäglichen Routinen Essen, Schlafen oder Wickeln gehandhabt werden, und welche anderen Bestandteile des Tagesablaufes die pflegerischen Maßnahmen »ergänzen«“ (Borke et al. 2011, S. 23).
Oftmals sind sehr junge Kinder anderer Kulturen auch noch wenig mit der deutschen Sprache vertraut. Die Bezugspersonen können die Kennenlernphase ggf. dafür nutzen, sich mit der neuen Kultur vertrauter zu machen, den Pädagog*innen etwas aus ihrer eigenen Kultur verständlich zu machen und das Kind darin zu unterstützen, Abläufe zu verstehen und am Gruppengeschehen teilzunehmen. Das Wahrnehmende Beobachten öffnet dann einen Raum für wertschätzende Begegnungen. Entscheidend ist hier, ob die Eltern spüren, dass der Vielfalt mit Offenheit und professioneller Responsivität begegnet wird.
Literatur